Künstler*innen
-
Ana Alenso

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann Pech und Blende
2 Bohrhämmer + Bohrstützen, Schläuche und Bohrstahl, Patronenhülsen, 0.50-BMGGeschosse, 3 Fotografien (gerahmt, 60 x 80 cm), Datenblätter Bohrhammer, 2024
In ihrer künstlerischen Arbeit befasst sich Ana Alenso u.a. mit der globalen Abhängigkeit von Ressourcen und der ökologischen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ausbeutung, die damit einhergeht. Dabei stellen Minen und Bergbau und damit zusammenhängende Fragen einen inhaltlichen Schwerpunkt der Künstlerin. Im Rahmen von SALZ. TON. GRANIT. erweiterte sie ihre Recherche zum Uranabbau und der vom Bergbau geprägten Folgelandschaft im Erzgebirge und recherchierte vornehmlich in Johanngeorgenstadt und Schlema - zwei Orten mit einer Schlüsselrolle in der Geschichte des Uranbergbaus in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Die Auswirkungen und Folgen dieser für die DDR wichtigen Industrie werden bis heute diskutiert und aufgearbeitet und voraussichtlich auch zukünftig nicht abschließend zu klären sein. Bis heute prägen die sozialen und gesundheitlichen, aber vor allem auch die ökologischen Auswirkungen des Uranbergbaus das Zusammenleben in der Region. Seit dem Ende des Abbaus saniert die Wismut GmbH - das Folgeunternehmen der gleichnamigen Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft (SDAG) - die Uranbergbauhinterlassenschaften mit unabsehbarem Ende.
Die Bohrhämmer, die Ana Alenso in ihrer Installation wie militärische Gegner_innen aufeinandertreffen lässt, waren im untertägigen Uranerzbergbau im erzgebirgischen Aue und Bad Schlema im Einsatz. Die von der Wismut GmbH geliehenen Geräte wurden sorgfältig gesäubert und strahlenschutztechnisch beurteilt. Dennoch ist noch heute eine radioaktive, wenn auch für die Ausstellungsbesucher_innen unbedenkliche Restkontamination z.B. im Inneren der Geräte, nicht ausgeschlossen. Die Bohrhämmer versinnbildlichen jedoch nicht nur die Auswirkungen, die die Arbeit unter Tage auf den menschlichen Körper hat - neben der radioaktiven Strahlung des Urans sind Bergleute Schadstoffbelastungen, Radonexposition, Emissionen aus dem Gestein und Staub ausgesetzt -, sie sind auch ein Zeichen für die Gewalt, die im menschlichen Handeln gegenüber der Natur verankert ist. Und stehen symbolisch für die Gewalt, die Uran durch sein radioaktives Potential entfesseln kann.
Bedingt durch die hohen Uranvorkommen im Erzgebirge wurde die SDAG Wismut schnell zum größten Produzenten von Uran im sowjetischen Atomprogramm und nahm eine Schlüsselrolle im atomaren Wettrüsten des Kalten Krieges ein. Weiter war das Unternehmen Wismut wie ein Militärbetrieb oder ein “Staat im Staat” organisiert und ermöglichte durch diesen Sonderstatus den Aufstieg der UdSSR zur nuklearen Supermacht. Die Rolle von Uran in globalen Konflikten gehört jedoch nicht der Vergangenheit an. Neben Angriffen auf nukleare Infrastruktur sollen im Russisch-Ukrainischen-Krieg Berichten zufolge Waffen mit Uranmunition von beiden Kriegsparteien eingesetzt worden sein. Der Einsatz dieser Waffen kann weitreichende und langfristige Folgen für die Zivilbevölkerung haben und erschwert den Wiederaufbau betroffener Gebiete, denn die Auswirkungen des Urans sind schwer zu beheben.
Die Schläuche der Bohrhämmer, die Teil des Pressluft- und Kühlsystems sind, sind in der Form eines Unendlichkeitszeichens angeordnet und bilden einen geschlossenen Kreislauf. Verdeutlicht wird so die zeitliche Dimension des Urans, die Vergangenheit prägt und gleichzeitig eine nicht zu überblickende und außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft liegende Zukunft zeigt. Der Kreislauf verdeutlicht auch, wie unterirdische Minen aufgrund ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen global miteinander verbunden sind. Nicht nur sind sie oftmals Glieder eines globalen Lieferkettensystems sondern auch Sinnbilder für den unersättlichen Expansionsdrang und die überbordende Extraktion, die überall auf der Welt stattfindet.

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann 
Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann ANA ALENSO beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Praxis mit den historischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen die Extraktivismus, globale Ressourcenpolitiken und der Handel mit Edelmetallen und fossilen Brennstoffen haben. Ihre Installationen sind oft temporäre und in sich geschlossene Assemblagen, die aus Skulpturen, Fotografien, Audio-Elementen und Video bestehen. Ihren poetisch-industriellen und dennoch düster-dystopischen Arbeiten gehen für gewöhnlich umfangreiche Recherchen und Feldstudien voraus. Sie nahm an Künstler*innen-Residencies am Goethe Institut Chile, der Villa Sträuli in der Schweiz und Urbane Künste Ruhr in Dortmund teil. Zu ihren aktuellen Ausstellungen gehören u.a. die Teilnahmen an Geneva Biennale: Sculpture Garden in der Schweiz; Street Fight im Museum of Modern Art in Warschau (Polen); Oil, Beauty and Horror in the Petrol Age im Kunstmuseum Wolfsburg; The Garden Bridge im Brücke Museum, El Museo de la democracia in der nGbK und Terrestrial Assemblage in der Floating University in Berlin. Sie hat einen MFA im Bereich Kunst im Kontext von der Universität der Künste Berlin (2015), einen MFA in Media Art & Design von der Bauhaus-Universität Weimar (2012) und einen BA von der Armando Reverón Arts University in Venezuela (2004).

-
András Cséfalvay

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann Prometheus Unbound, Total sacrifice. For three voices, sung sadly but with vigor
Videooper, 20 min, 2024
András Cséfalvays Arbeit ist durch das lyrische Drama “Prometheus Unbound” inspiriert, geschrieben vom britischen Autor und Romantiker Percy Bysshe Shelley. Auf Grundlage des erstmals 1820 veröffentlichten Textes, hat András Cséfalvay eine Videooper in drei Akten animiert, die über das menschliche Streben nach unbegrenzter Energie nachdenkt. Und über den Preis, den wir bereit sind, dafür zu zahlen. Dabei verbindet er Mythologie mit einer science-fiction ähnlichen Ästhetik und formuliert folgende Fragen: Inwiefern ist die Menschheit bereit, auf das, was wir wissen, zu vertrauen? Welche Wirkmacht trauen wir dem zu und sind wir bereit, auf Fortschritt zu setzen? Und wie wird unser Nachdenken über Kernenergie und ihre Hinterlassenschaften von dem Wunsch beeinflusst, die Natur zu beherrschen? Die Videoarbeit entfaltet diese Fragen mit der Hilfe von drei mythologischen Figuren - Prometheus, Asia und Cosmia -, die alle unterschiedliche Positionen vertreten. Die Grundlage für das Bühnenbild bildet eine ortsspezifische Recherche im Lager für schwach- und mittelradioaktiven Abfälle im ungarischen Bátaapáti. Die unterirdischen Tunnel und Behälter aus Beton, in denen die Abfälle gelagert werden, werden in András Cséfalvays Videooper zur Kulisse seiner Protagonist_innen und zum Schauplatz ihrer gesungenen Dialoge. In diesen besingen und diskutieren sie eine ultimative Utopie: Den Übergang von der Kernspaltung zur Kernfusion. Dadurch würde unendlich viel Energie freigesetzt, eine Errungenschaft, die mit Blick auf den Energiebedarf nachhaltiger Lebensweisen erstrebenswert erscheint. Entsprechend seiner mythologischen Vorlage, in der Prometheus der Menschheit das Feuer bringt und dafür von den Göttern bestraft wird, fordert die Figur des Prometheus in der Videooper seine Befreiung aus der Gefangenschaft und verspricht im Gegenzug, das Wissen über Energieproduktion mit de Menschen zu teilen. Die künstlerische Arbeit führt demnach automatisch zu der Frage, ob wir diesen Weg gehen sollten. Und - wenn ja - was er mit sich bringt.
„Das oberste Ziel von Kultur ist es, zu beherrschen“, singen die Nymphen. „Wie kann etwas ohne Gewalt verändert werden? Das ist die ökologische Frage!“ Im Zentrum der Arbeit von András Cséfalvay steht die derzeitige gesellschaftliche Debatte über Energiezukünfte, die grüne Transformation [Green Transformation] die dringend gebraucht wird, und die Klimakatastrophe, deren Auswirkungen weltweit spürbar sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob technologische Lösungen möglich und wünschenswert sind. Ist es überhaupt angebracht, optimistisch auf den Bereich der Technik zu blicken? Die künstlerische Arbeit regt dazu an, über die Beziehung zwischen Mensch und Natur nachzudenken. Gleichzeitig stellt sie den Zwiespalt zwischen Wissenschaft und Kontrolle in den Vordergrund: „Ich will dich kennen, damit du keine Macht über mich hast. Aber ich will dich nicht so gut kennen, dass ich dich überwältigen könnte. singen András Cséfalvays’ mythologische Figuren und betonen somit die oftmals übermenschlichen Auswirkungen unseres Handelns.
In der eigens für die Ausstellung SALZ. TON. GRANIT. produzierte Arbeit verbindet der Künstler sein langjähriges Interesse an den Verflechtungen von Wissen, Wissenschaft und Macht mit seiner vielschichtigen künstlerischen Praxis. Dabei verknüpft er konzeptuelle Kunst und experimentelle Musik, dystopische und dennoch hoffnungsvolle Mytho-Poesi und spekulative Erzählungen und lädt so dazu ein, sich mit einer weitreichenden philosophischen Frage zu befassen: Dem Spannungsverhältnis zwischen Kultur und Technologie. Und während er auf den Nutzen und die Wahrheit, die in Fiktionen gebündelt sind, hinweist, untermauert er seine kritischen Überlegungen mit Humor.
Die Gemeinde Bátaapáti und das Atommülllager prägen die Videooper nicht nur als animiertes Bühnenbild, der Künstler hat subtil ein kollaboratives Element in die Arbeit einfließen lassen. Der auf ungarisch eingesungene Refrain entstand mit Schülerinnen der örtlichen Grundschule und verwandelt sich in der Klanglandschaft der Oper zum Rauschen des Meeres, das die Besucherinnen der Ausstellung als eine Art Fantasiesprache wahrnehmen können.

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann ANDRÁS CSÉFALVAY (1986) ist ein bildender Künstler, digitaler Geschichtenerzähler und Mytho-Poet aus Bratislava, der derzeit an der Akademie der Bildenden Künste in Bratislava unterrichtet. Nach seinem Studium der Malerei und Mathematik schrieb er eine Dissertation über den Nutzen und die Realität der Fiktion. Er befasst sich mit der Beziehung zwischen Kultur und Technologie sowie mit den politischen und ethischen Aspekten des Zuhörens auf nicht dominante Stimmen in der Weltinterpretation. Seine jüngsten Arbeiten befassen sich mit der Beziehung zwischen Astronomen und indigenen Völkern beim Bau der Mauna-Kea-Teleskope, dem Flug der Dinosaurier als Überlebenstechnologie nach dem Aussterben und der Neukategorisierung des Planeten Pluto. Er ist Empfänger des Oskar Čepan Young Visual Artist Price, Mitglied des Neuen Zentrums für Forschung und Praxis und Mitbegründer der Plattform für digitale Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in Bratislava. Er stellte unter anderem in den KunstWerken Berlin, Art In General New York, Trafo Gallery Budapest, Firstdraft Sydney und Karlin Studios Prag aus.
http://www.andrascsefalvay.com/

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann -
Krisztina Erdei mit Dániel Misota

Foto vom Filmdreh Taking Time © Kristztina Erdei Sich Zeit nehmen
3-Kanal-Video, 2024
In einer Videoinstallation verbindet sich der langfristige Austausch der Künstlerinnen Krisztina Erdei und Dániel Misota mit der Dorfgemeinschaft von Bátaapáti. Seit 2011 beheimatet die Gemeinde im ungarischen Landkreis Tolna ein Endlager für schwache und mittelradioaktive Abfälle. Die künstlerische Recherche untersucht die komplexen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen die das Endlager auf das Leben in der Gemeinde hat. Dabei werden die Beteiligung der Dorfgemeinschaft, künstlerische Intervention und persönliche Erzählungen miteinander verwoben. Dabei legen Krisztina Erdei und Dániel Misota ihr Hauptaugenmerk auf die privaten und nicht-offiziellen Geschichten der Dorfbewohnerinnen, die ihren Alltag im vermeintlich bedrohlichen Schatten des Atommülllagers verbringen. Über ein Jahr lang kehrten die Künstlerinnen regelmäßig nach Bátaapáti zurück und haben persönliche Beziehungen zu Bewohnerinnen aus unterschiedlichen Generationen und mit unterschiedlichen Hintergründen aufgebaut. Aus diesem Austausch entstand eine Sammlung von persönlichen Geschichten, die widerspiegeln, wie unterschiedlich in der turbulenten Geschichte Bátaapáts in den vergangenen zweihundert Jahren gelebt, gearbeitet und geliebt wurde. Die individuellen Erzählungen stehen den politisch und wirtschaftlich bedeutsamen und „großen”Erzählungen gegenüber. Dieser Gegensatz wird im Rahmen der künstlerischen Arbeit untersucht, berücksichtigt wird dabei, wie die Existenz des Endlagers das kollektive Gedächtnis, den Umgang mit geteiltem Raum und die alltäglichen Begebenheiten in der Gemeinde verändert.
Der zentrale Film der 3-Kanal-Videoinstallation porträtiert die Gemeinde Bátaapáti durch die Aneinanderreihung kurzer Filmszenen in denen die bereits beschriebenen gesammelten Geschichten durch die Dorfbewohnerinnen mitgestaltet und nachgestellt werden. Die Schauplätze und Protagonistinnen werden von den Künstler_innen durchgewechselt, wodurch eine dynamische Betrachtung der geteilten Geschichte der Dorfgemeinschaft entsteht. Gleichzeitig konfrontieren die unterschiedlichen Momentaufnahmen die enorme Zeitlichkeit, die sich durch die Halbwertszeit der nahegelegenen radioaktiven Abfälle ergibt.
Dieser komprimierten Betrachtung der Mikrogeschichte von Bátaapáti werden zwei sich langsam bewegende, fast statische Szenen beiseite gestellt. Eine zeigt das Innenleben des Endlager, die Kamera erkundet die organische Textur der Wände der unterirdischen Tunnel erkundet und kontrastiert sie mit den sorgfältig gefertigten Kisten für radioaktive Abfällen. Die zweite Szene verweilt auf dem Kirchturm von Üveghuta, einsam gelegen in einem Wald in der Nähe von Bátaapáti. Die Kirche ist das einzige Relikt eines einst lebendigen Dorfes der in Ungarn lebenden deutschen Minderheit, und dessen Hinterlassenschaften sonst vollständig von der Natur zurückerobert wurden. Der Turm ist ein Zeugnis lokaler historischer Veränderungen. Durch den Zusammenbruch des Weinbaus erlebte die Region zu Beginn des 20. Jahrhundert einen rasanten wirtschaftlichen Niedergang, der durch die Zwangsumsiedlung der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg noch verstärkt wurde.
Die Gegenüberstellung dieser beiden unterschiedlichen Umgebungen - das Endlager für radioaktive Abfälle und die verlassene Siedlung - regt zum Nachdenken an. Wie flüchtig wirken menschliche und persönliche Anliegen und Wünsche zwischen den großen Erzählungen der Geschichte? Und wie erscheinen sie im Abgleich mit den unergründlichen und übermenschlichen Ausmaßen, der “deep time” nuklearer Zeitlichkeiten?
Die Arbeit reflektiert, wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verwoben sind und betrachtet das Spannungsfeld zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Kräften im Anthropozän. Gleichzeitig stellt sie offizielle und wissenschaftliche Dokumentationen und historischer Erzählungen in Frage, indem sie individuelle Narrative über die Objektivität von Archivmaterial stellt. Dadurch entsteht ein Dialog zwischen dem lokalen Kontext und globalen Themen wie Ökologie, radioaktiver Halbwertszeiten und den Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt. Das komplexe soziale und kulturelle Gefüge in der Region befeuern im Rahmen der künstlerischen Arbeit kritische Fragen über die Beziehung zwischen materiellen Beweisen und persönlichen Erinnerungen. Die Videoarbeit ist ein eindringlicher Kommentar dazu, wie menschgemachte Strukturen, wie etwa das Endlager - der „Atomfriedhof“ -, den zeitlichen Horizont Bátaapátis in eine unvorstellbare Zukunft verlängern und die Vergänglichkeit menschlichen Lebens mit einem dauerhaften radioaktiven Erbe konfrontiert wird.
Besonderer Dank an Réka Kuris, Attiláné Kuris, Jázmin Kuris, Dávid Durgonics, BalázsZele, Kata Kocsor, Zsófia Margetin, Levente Farkas, Tamás Farkas , Artúr Forrai, Martin Braun, Mirtill Forrai, Attila Schafer, János Nagy, Mónika Illésné Nagy, Csaba Illés, János Horváth, Jánosné Horváth, Sándor Torac, József Utasi, József Sári, Józsefné Sári, Sándorné Oláh, Elizabet Víg, Izabell Víg, Anett Vígné Csereklei, Gábor Máté, Dorottya Tóth, Zsoltné Tóth, Gábor Tornóczky, Gáborné Tornóczky, András Zele, Andrásné Zele, Zoltán Ferenczi, Zoltán Kern und an die Schüler_innen der lokalen Grundschule.

Installationsansicht © Virág Major-Kremer / SALT. CLAY. ROCK 
Installation view SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann KRISZTINA ERDEI (Budapest) ist bildende Künstlerin. An der Universität Szeged studierte sie Philosophie und an der Moholy-Nagy-Universität für Kunst und Design promovierte sie im Bereich Multimediakunst zum Thema „Kampf um deine Geschichte. Studien der Erinnerung und zeitgenössische Kunst im 21. Jahrhundert“. Weitere Schwerpunkte sind visuelle Kultur sowie interdisziplinäre und kollaborative Kunstpraktiken. Indem sie erforscht, wie Kommunen und Gemeinschaften zusammenhalten und sich vernetzen, sucht sie nach den bestimmenden Merkmalen, die kollektives Handeln formen und ermöglichen. Aktuell studiert Erdei an der Doktorandenschule für Philosophie der Eötvös Loránd Universität und arbeitet als Assistenzprofessorin an der Partium Christian University und als Kunstkritikerin für das satirische Wochenmagazin Magyar Narancs. Ihre Arbeiten mit Kommunen und deren Menschen entstehen durch Krisztina Erdei‘s große Sensibilität. Obwohl sie offen für verschiedene Medien ist, arbeitet sie dabei vor allem fotografisch aus einem kritischen Blickwinkel heraus. Ihre Bilder scheinen zwanglos, instinktiv, oft zufällig zu entstehen, beim genaueren Betrachten zeigen sich jedoch komplexe Zusammenhänge. In ihren vielschichtigen Werken lädt sie die Betrachter_innen aktiv dazu ein, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, während sie meinungsstark und zugleich wohlwollend die Grundwerte der humanistischen Fotografie heraufbeschwört und sie im Kontext des 21. Jahrhunderts neu interpretiert.
DÁNIEL MISOTA (Budapest, geboren 1992) ist ein Filmemacher und Medienkünstler aus Budapest, der in seinen Arbeiten Filmstil als künstlerischen Mittel zur kritischen Auseinandersetzung auslotet. Nach seinem Abschluss an der Moholy-Nagy-Universität für Kunst und Design im Jahr 2022 arbeitete er europaweit als Kameramann an verschiedenen Kunst-, Film- und Fernsehprojekten. Dabei kam es zu eindrucksvollen Kooperationen mit Joseph Tasnadi’s „La Primavera“ und mit Talya Feldman bei ihrer Mehrkanal-Filminstallation „Psithurism“. Sein Dissertationsfilm „Mária Kerényi, 41, Juli 1970“ - ein Reenactment eines Propagandafilms aus den 1970er Jahren – war im MODEM Zentrum für moderne und zeitgenössische Kunst in Debrecen im Rahmen der Ausstellung „Re:Re: Künstlerische Re-Inszenierungen, die Kunst der Re-Inszenierung“ zu sehen. Derzeit promoviert er zu emanzipatorischen filmischen Formen. https://www.instagram.com/daniel_probablement/

Krisztine Erdei und Dániel Misota in Bátaapáti -
Csilla Nagy und Rita Süveges

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann Die Zeit überdauern
Videoinstallation und keramische Objekte, 2024
Csilla Nagy und Rita Süveges wurden im Rahmen von SALZ. TON. GRANIT. eingeladen, eine künstlerisch geführte Exkursion - einem artist-led field trip - zu entwickeln. Die Künstlerinnen wählten für das ortsspezifische Format das Dorf Boda, eine kleine Gemeinde, in der das ungarische Unternehmen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle (PURAM) wiederholt Probebohrungen durchführt. Anhand der Bohrungen soll festgestellt werden, ob die unter dem Dorf gelegene Tonsteinformation die Bedingungen erfüllt, die gegeben sein müssen, um hochradioaktive Abfälle zu lagern. Die Unsichtbarkeit dieser Eingriffe im Auftrag nuklearer Infrastruktur - die Bohrungen sind lediglich durch einen blauen Baucontainer am Rande Bodas zu erkennen - stellen Csilla Nagy und Rita Süveges jener ungreifbaren Zeitlichkeit gegenüber, die durch nukleare Halbwertszeiten, die Millionen von Jahren dauern, vorgegeben wird.
Mitte Juli, an einem der heißesten Tage des Sommer 2024, fand in Boda im „Infopark“ der PURAM eine performative und partizipatorische Diskussionsrunde statt. Danach folgte das gemeinschaftliches Brennen von Keramik in einer Brenngrube im Freien – eine altertümliche Technik des Tonbrennens. Dafür bereiteten die Künstlerinnen sechseckige Formen aus Ton vor, die von den in Kernkraftwerken verwendeten Brennstäben erinnern und durch das Forschungsfeld der “Atomsemiotik“ inspiriert sind, das sich u.a. mit der Frage befasst, wie wir mit künftigen Generationen menschlicher und nicht-menschlicher Lebewesen über den Standort und die Gefahren eines Atommülllagers kommunizieren können. Wie sehen die Warnungen aus? Welche Sprachen und Symbole werden hier genutzt? Könnte gebrannter Ton als Kommunikationsmittel geeignet sein? Denn letztlich sind Keramiken oft die einzigen dauerhaften Spuren von vergangenen Zivilisationen, anhand derer Archäolog_innen versuchen zu verstehen, wie Menschen einst gelebt und gearbeitet haben.
Die Künstlerinnen verstanden den Grubenbrand als Möglichkeit, die sonst unsichtbare Infrastruktur der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle und die Auseinandersetzung mit der „Tiefenzeit” sichtbar und durch diese Verwandlung von Materialien auch erfahrbar zu machen. Denn eine der größten Herausforderungen bei der Lagerung hochradioaktiven Mülls ist, dass dieser viel Hitze generiert und aufgrund seiner toxischen Radioaktivität in tiefen, minierten geologischen Lagerstätten verschlossen werden muss.
In der Ausstellung ordnen die Künstlerinnen nun die in Boda gebrannten sechseckigen Tonformen in einer Reihe an, die an Brennstäbe, die Hauptquelle für hochradioaktive Abfälle und an Bohrkerne erinnern, die aus den geologischen Untersuchungen, die für die Endlagersuche notwendig sind, entstehen. Dabei verdeutlicht die Zerbrechlichkeit des gebrannten Lehms die Risiken und Gefahren, die durch die Lagerung von Atommüll entstehen. Gleichzeitig interessieren sich Csilla Nagy und Rita Süveges dafür, wie eine Dorfgemeinschaft, die nur wenige Hundert Mitglieder zählt, mit der Verantwortung umgeht, Entscheidungen zu treffen, die sich langfristig auf zukünftige Generationen auswirken. Für diese Auseinandersetzung infiltrierten sie im Rahmen ihres artist-led field trips den Infopark der PURAM, der als “offizieller” Diskursraum für diese Auseinandersetzung verstanden werden kann, um dort auch kritische Stimmen zuzulassen.
Vor diesem Hintergrund organisierten sie eine offene Diskussionsrunde. Teilnehmerinnen waren der Bürgermeister von Boda, ein ehemaliger Uranbergarbeiter, ein für PURAM tätiger Hydrogeologe und eine Umweltaktivistin aus der nahe gelegenen Regionalhauptstadt Pécs. An der offenen und teils hitzigen Diskussion beteiligte sich auch das Publikum, u.a. die Bürgermeister aus den umliegenden Dörfern sowie Expertinnen aus den Bereichen Geologie und Ingenieurwesen, die sich mit der Frage der der Endlagerung radioaktiver Abfälle befassen. Offengelegt wurden Zusammenhänge zwischen dem Uranbergbau in der Region und den anhaltenden geologischen Untersuchungen, die bereits während der Zeit des Sozialismus begonnen und durch politische Veränderungsprozesse sowie neoliberale Denkweisen beeinflusst wurden. Ebenso deutlich waren die Perspektiven der Bürgermeister, die hoffen, durch die Entschädigungen für die Probebohrungen die Zukunft ihrer Gemeinden zu sichern. Zugrunde liegt das Narrativ, dass Boda und die umliegende Region ein “geopfertes” Gebiet des lokalen Bergbaus seien. Nicht berücksichtigt werden in dieser Erzählung die Folgen, die dieser Extraktivismus für die Menschen hat, denn die Geschichte der Bergleute ist geprägt von Krankheiten, Beeinträchtigungen und vorzeitigem Tod. In diesem Zuge wurde deutlich, dass es notwendig ist, transparenter über die potenziellen Risiken eines Endlagers zu informieren und zu kommunizieren.
Denn die regionale Geschichte des Bergbaus ist gleichzeitig eine Geschichte über Solidarität. Das greifen die Künstlerinnen in ihrer Videoarbeit auf, der die Dokumentation der ortsspezischen Intervention zugrunder liegt und die u.a. den Moment dokumentiert, in dem die an der Diskussion beteiligten Bergleute und Geologen ein Bergbaulied anstimmen, und einen ein bewegendes Beispiel schaffen für die interdisziplinäre Solidarität zwischen Berufen, die sich der Arbeit unter Tage widmen.

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann 
Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann CSILLA NAGY Ein immer wiederkehrendes Element in Csilla Nagys Werk sind Formen des Gedenkens und Strategien, wie Individuen oder Gemeinschaften an Ereignisse erinnern, die für sie von Bedeutung sind. Das Thema der Erinnerung ist für Csilla Nagy eine Konstante, die sich zwischen dem Privaten und dem Globalen bewegt. Einerseits versucht sie, ihr enges Umfeld zu beobachten und zu reflektieren, andererseits ist sie auf der Suche nach einem größeren Kontext. In den letzten Jahren hat sich die Künstlerin für Keramik interessiert, die sie in ihre künstlerische Praxis integriert: Sie verwendet Ton in einer konzeptionellen und experimentellen Weise, probiert alte Techniken und neue Methoden aus.
Csilla Nagy wurde mit dem Derkovits-Stipendium, dem Visegrad-Stipendium und dem Kunststipendium der Ungarischen Akademie in Rom ausgezeichnet. Seit 2018 ist sie Assistenzprofessorin an der J. Selye Universität in Komárno (Slowakei) und lebt und arbeitet in Galanta (Slowakei).
https://www.csilla.xyz/
RITA SÜVEGES (Budapest) arbeitet als bildende Künstlerin. Ihre künstlerische Praxis ist theoretisch untermauert, und in groß angelegten Performances sie arbeitet eng mit Kommunen und ihren Menschen zusammen, um Wissen zu vermitteln, während sie für White Cube Installationen eine Vielfalt an Medien nutzt. Ihre Themen sind geprägt von der Umwelt- und Klimakrise und in ihren Arbeiten will Süveges dringende Probleme repolitisieren, um sie durch die Vorstellungskraft der Kunst in ein breiteres gesellschaftliches Verständnis zu überführen. Aktuell ist sie Doktorandin der Freien Künste an der Ungarischen Akademie der Schönen Künste und beleuchtet in ihrer bevorstehenden Dissertation Geoengineering und Technooptimismus aus feministischer Perspektive.Für ihre Arbeiten wurde sie mit verschiedensten Preisen und Stipendien ausgezeichnet, unter anderem dem „TÓTalJOY“, dem „Smohay“, dem New National Exception Grant, dem Derkovits- und dem Visehrad-Stipendium. Sie war außerdem für den Strabag- und den Esterhazy-Kunstpreis nominiert.
Zu ihren Residencies zählen die Cité des Arts de Paris, ISCP New York, Meetfactory Prag, MQ/Q21 AIR Wien, Balatorium, Künstlerdorf Schöppingen und viele mehr. Nach mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen in Ungarn stellte sie auch international u.a. im Museum Ludwig in Koblenz, auf der Off-Biennale Budapest und im Collegium Hungaricum Berlin aus. Und als Mitbegründerin der Künstlergruppe „xtro realm“ organisiert sie seit 2017 Lesekreise, Ausstellungen und Exkursionen, die unter Einbezug ökologischer Theorien den Anthropozentrismus des zeitgenössischen Denkens durchleuchten. Sie war Herausgeberin, Autorin und Gestalterin von „extrodæsia“- Encyclopedia Towards a Post-Anthropocentric World und des Climate Imaginary Reader. Darüber hinaus kuratierte Süveges die Gruppenausstellung von ACLIM! im Rahmen der OFF-Biennale Budapest 2021 ACLIM! Und war von 2018 bis 2021 Vorstandsmitglied der „Studio of Young Artists‘ Association“.

Csilla Nagy and Rita Süveges at their OVERCOMING TIME artist led field-trip in Boda Hungary -
Sonya Schönberger

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann Gott mit uns (250 Millionen <-> 1 Million)
Multimedia-Installation mit Tapete, Video, Salzsteinen, 2024Sonya Schönberger untersucht in ihrer multimedialen Installation den Zusammenhang zwischen Bergbau und der Lagerung radioaktiver Abfälle in der ehemaligen Salzmine von Morsleben in Sachsen-Anhalt, dem DDR-Endlager für schwach und mittelradioaktiven Abfall, das nunmehr als Endlager bestehen bleiben wird. In der Arbeit verbinden sich die Eigenheiten von Salz mit der Geschichte der Schächte “Marie” in der Gemeinde Beendorf und “Bartensleben” in der Gemeinde Morsleben. Beide Gemeinden spielen in der künstlerischen Auseinandersetzung eine wichtige Rolle, Morsleben lag beispielsweise im stark kontrollierten Grenzgebiet, Angestellte des Atommülllagers benötigten Passierscheine um hier arbeiten zu können, sofern sie nicht in Morsleben lebten. Im benachbarten Beendorf befindet sich wiederum ein kleines und ehrenamtlich geführtes Museum, das sich mit der Geschichte der Zwangsarbeit im Schacht “Marie” zur Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Diesen Blick in die jüngere Vergangenheit stellt die Künstlerin den unfassbaren Zeitlichkeiten gegenüber, die sich aus der Geschichte des Salzgesteins ergeben und die für die Zukunft der Atommülllagerung gültig sind.
Der Kali- und Steinsalzbergbau im Oberen Allertal hat seinen Ursprung in Beendorf, wo der Unternehmer Gerhard Korte den ersten Schacht in der Region bauen ließ. Sein Bergbauunternehmen trug den Namen “Gott mit uns”. Der Schacht selbst wurde nach seiner Kortes Frau benannt und in 1897 als Schacht „Marie“ geteuft. Bis 1969 wurden in den untertägig verbundenen Gruben Marie und Bartensleben - der kurze Zeit später in Betrieb genommen wurde - und die heute das Endlager Morsleben bilden, Kali- und Steinsalz gefördert.
Das Ortsbild Beendorfs ist bis heute von einem massiven Salzaushub geprägt, der damals aus der Erde geholt wurde. Diese überirdische Hinterlassenschaft des Salzbergbaus verbindet Sonya Schönberger mit dem gigantischen Kosmos, der sich direkt darunter - Untertage - befindet. Eine Kamerafahrt verdeutlicht, welche Ausmaße die verbundenen Schächte haben und zeigen die in das Salz gegrabene System aus Tunneln und Kammern, in dem ab 1944 Zwangsarbeiter_innen aus ganz Europa für die Nationalsozialistische Rüstungsindustrie arbeiten mussten. Diese lässt Sonya Schönberger in Form von Zitaten zu Wort kommen, die sie der umfangreichen Publikation “Rüstung unter Tage” von Björn Kooger aus dem Jahr 2004 entnommen hat und das das Unrecht und die Verbrechen unter Tage schildern. Die Zeugnisse stemmen sich dagegen, diesen Teil der Geschichte mit dem Verfüllen des Endlagers ebenfalls zu begraben.
Fast wie Zitate aus Stein fungieren die Salzsteine, die die Künstlerin aus der Grube in den Ausstellungsraum überführt hat. Diese Spuren von Geschichte des Morlsebener und Beendorfer Salzes, die inzwischen etwa 250 Millionen Jahre andauert, sind Ankerpunkte geologischer Zeiten, die auf unendliche Zeiträume sowohl in der Vergangenheit als auch der Zukunft der Orte Morsleben und Beendorf verweisen. So hat sich der Salzstock, in dem heute schwach und mittelradioaktiver Müll eingelagert wird, während der als Zechstein bezeichnete geologische Epoche gebildet und ist durch tektonische Verschiebungen und Druck aus größerer Tiefe in ihre heutige Position gewandert. Dieser Umstand verdeutlicht ein wichtiges Charakteristikum von Salz, das es als Material für die Endlagerung qualifiziert: Es ist ein nicht sprödes, duktiles (verformbares), aber dennoch hartes Gestein und erfüllt damit viele Kriterien, die bei der Endlagersuche angewendet werden. Demnach ist es die große Aufgabe der Bundesgesellschaft für Endlagerung, die in Morsleben auch ein Informationszentrum zu ihrer Forschung Untertage betreibt, innerhalb der Salzstrukturen geeignete Bereiche für ein mögliches Endlager und damit für die kommenden eine Million Jahre zu finden.
Besonderer Dank an Anna Byskov, Swantje Claußen (BGE), Hildegard und Klaus Ebel, Christian Guinchard und Laetitia Ogorzelec (LaSA, Laboratoire de sociologie et d'anthropologie, Université Franche-Comté), Claus Hansper, Claire Kueny (ISBA Besançon), Péter László Horváth (BGE), Annette und Torsten Kniep, Flo Maak, Sven Petersen (BGE), Karla und Hartmut Schulze und Christof Zwiener.

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann 
Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann SONYA SCHÖNBERGER ist eine in Berlin lebende Künstlerin, deren Praxis sich mit biografischen Brüchen vor dem Hintergrund politischer oder sozialer Umwälzungen auseinandersetzt. Quelle ihrer künstlerischen Auseinandersetzung sind die Menschen selber, die in biografischen Gesprächen darüber berichten. So sind einige Archive entstanden, aber auch bereits existierende, zum Teil gefundene Archive fließen in ihre Arbeit ein. Vor fünf Jahren rief sie das "Berliner Zimmer" ins Leben, ein langzeitlich angelegtes Videoarchiv basierend auf den Erzählungen der Menschen in Berlin.
www.sonyaschoenberger.de
www.berliner-zimmer.net
-
Marike Schreiber

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann 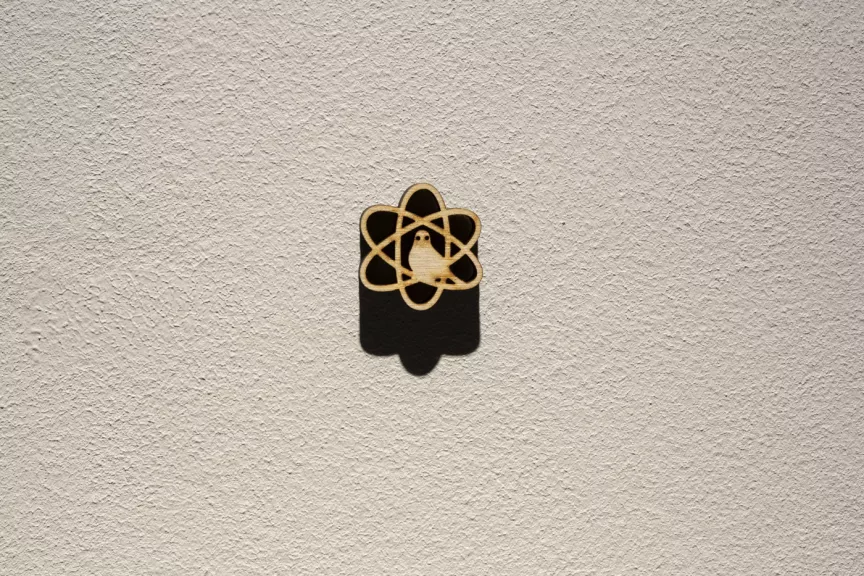
Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann OH STRAHLENDER STECHLIN
Multimedia-Installation mit Bar-Skulptur, Medaille und Schmuckkästchen, Tapete und Audio, 2024
Im September 2024 lud Marike Schreiber zu einer künstlerisch geführten Exkursion - einem artist-led field trip - in das Naturschutzgebiet Stechlin und zum ehemaligen Kernkraftwerk Rheinsberg im Norden Brandenburgs ein. In der vorhergegangenen Recherche interessierte sich die Künstlerin für die Verbindungen des Kernkraftwerkes zum es umgebenden Naturschutzgebiet mit dem Stechlinsee, der lange Zeit eine Schlüsselrolle als „Kühlungsanlage” des Kraftwerkes spielte. Gleichzeitig ist der Klarwassersee noch heute für seine gute Wasserqualität und große Biodiversität bekannt. 1959 entstand hier die Abteilung Experimentelle Limnologie (Wissenschaft von den Binnengewässern) als Außenstelle des Zentralinstituts für Mikrobiologie und Experimentelle Therapie (ZIMET) Jena. Nach der Wende wurde die Forschungsarbeit 1992 weitergeführt. Noch heute befassen sich die Forscher_innen des im Jahr 2000 in die Leibniz-Gesellschaft aufgenommenen Seelabors für Gewässerökologie und Binnenfischerei u.a. mit den Auswirkungen des Kraftwerksbetriebs auf den See und sein Ökosystem.
Im Rahmen von SALZ. TON. GRANIT. ist das Kernkraftwerk Rheinsberg und seine Geschichte grundlegend für die Auseinandersetzung mit dem Erbe nuklearer Infrastrukturen. 1966 als erstes Kernkraftwerk der DDR in Betrieb genommen, wird es seit 1995 als erstes Kernkraftwerk überhaupt gänzlich zur „grünen Wiese” zurückgebaut.
Sowohl der artist-led field trip sowie die in der Ausstellung gezeigte Arbeit befassen sich eingehend mit dieser Geschichte und zeigen die Kontroversen auf, die sich darin abbilden. Ein wichtiger Bezugspunkt für Marike Schreibers Arbeit ist das Werkstor des Kernkraftwerks. Bis heute zeigt es eine Friedenstaube, eines der in der DDR am häufigsten verwendeten politischen Symbole und ein Hinweis auf die politische Betonung der friedlichen Nutzung der Kernenergie mitten im Kalten Krieg. Zur Eröffnung des Kernkraftwerks erhielten alle am Aufbau beteiligten Arbeiter_innen eine von zweitausend extra zu diesem Zweck angefertigten Medaillen. Auf der Vorderseite war die Friedenstaube im Atommodell abgebildet. Auf der Rückseite stand: “In Anerkennung für Ihre Mitarbeit beim Aufbau des 1. Atomkraftwerks der DDR Rheinsberg 9.5.1966”.
Gleichzeitig befasst sich die Arbeit mit den „Umweltsonntagen”, die der Pfarrer Reinhard Dalchow in der evangelischen Kirchengemeinde in Menz als Reaktion auf die Umwelteinflüsse des Kernkraftwerks in den 1980er Jahren mit initiiert hat. Ziel der Reihe war eine offene Diskussion über Umweltschutz und die Folgen der Energiegewinnung in der DDR. Für die erste Veranstaltung wurde das Thema Wasser und Wasserverschmutzung gewählt, über die es zu diesem Zeitpunkt keine öffentliche Diskussion gab. Mit einem „Wasserempfang” in der Kirche - die als Institution ein Schutzmantel für Widerstandsbewegungen in der DDR war - wurde auf die Bedeutung von sauberem Trinkwasser aufmerksam gemacht.
Die beschriebenen Aspekte greift Marike Schreiber, deren künstlerisches Interesse u.a. den Formen wissenschaftlicher Abbildungen und in Bilder übersetzten Daten, Modellen und metaphorischen Begriffen gilt, auf und überführt diese in skulpturale Arbeiten, die im Rahmen des artist-led field trip genutzt und nun im Ausstellungsraum in einer Rauminstallation gezeigt werden. Sowohl die Medaille als auch die Bar für einen Wasserempfang finden sich wieder. Die ikonische Friedenstaube sitzt jedoch nun und spielt so auch auf den Systemwechsel an, der das Ende des 1990 abgeschalteten Kernkraftwerks bedeutete. Die Bar-Skulptur besteht aus mehreren Elementen, die durch drei Stäbe verbunden sind und die Tiefenschichten des Stechlinsees darstellen. Die Anordnung der Gläser auf der Bar und die achteckige Form der Bar selbst beziehen sich auf die Anordnung der 24 Seezylinder des Seelabors im Stechlinsee. Die Behälter mit Seewasser verweisen auf die Diskrepanz zwischen dem über Jahre verunreinigtem und dennoch als sauber geltenden Wasser des Stechlinsees. Bei Führungen in der Ausstellung wird die Bar aktiviert und die Besucher_innen zum Wasserempfang eingeladen.
Zur Finissage der Ausstellung findete ein Umweltsonntag statt, zu dem die Künstlerin gemeinsam mit dem Pfarrer i.R. Reinhard Dalchow und dem Paläontologe Björn Kröger einlud.
Besonderer Dank an AG Rheinsberger Bahnhof, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Reinhard Dalchow (Initiator „Umweltsonntage”), Jörg Möller (Verein Stadtgeschichte Rheinsberg), Grit Ruhland (Soundaufnahme)

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann 
Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann MARIKE SCHREIBER (*1982 in Neustrelitz) lebt und arbeitet in der Mecklenburgischen Seenplatte. Sie studierte Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und leitete mit Ari Merten und Yvonne Anders von 2008 bis 2019 den Leipziger Kunstraum Praline, der Ausgangspunkt für beteiligungsorientierte Formate und ortsspezifische Ausstellungen war.
Marikes künstlerisches Interesse gilt der Beschaffenheit von wissenschaftlichen Abbildungen: die Formen und Farben der in Bilder übersetzten Daten, Modelle und metaphorischen Begriffe, welche als Chiffren eines bestimmten Blickes auf die Welt – von Vorstellungen des Mensch- und/oder Natur-Seins verstanden werden können. Diese zweidimensionalen Abbildungen verwendet sie als Material für modellhafte Skulpturen und Installationen.

-
Katarina Sevic

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann Something Man-made Is Here
Soudinstallation, grafische Partitur, 2024Katarina Sevic ist in doppelter Funktion am Projekt SALZ. TON. GRANIT. beteiligt: Sie hat die visuelle Identität des Projektes entwickelt, ihre Recherchen für das Grafikdesign bildet gleichzeitig die Grundlage für eine neue künstlerische Arbeit, die sie für die Ausstellung entwickelt hat. Anders als die anderen beteiligten Künstlerinnen, deren Arbeiten ortsspezifisch eingebettet sind sich und in der Ausstellung mit der künstlerisch-kuratorischen Forschung die dem Projekt zugrunde liegt verbinden, gilt Katarina Šević Interesse dem übergeordneten Feld der “Atomsemiotik”. In diesem Zuge befasst sie sich mit verschiedenen visuellen Kommunikationsformen, die in nukleare Kultur eingeschrieben sind, und untersucht wie diese Zeichen und Symbole sowohl von Befürworterinnen als auch von Kritiker_innen der Kernkraft und der Anti-Atom-Bewegung verwendet werden. Die Atomsemiotik ist ein herausforderndes, höchst spekulatives und ausgesprochen konzeptionelles Forschungsfeld. Ein erklärtes Ziel ist es, Sprache und Kommunikation - wie wir sie heute verstehen - zu verändern und sich mit der (Un-)Möglichkeit auseinanderzusetzen, künftige Generationen menschlichen und nicht-menschlichen Lebens vor den Gefahren radioaktiver Endlager zu warnen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Designsprachen, Zeichen und Signale entwickelt werden müssen, die über die Dauer von 100.000 Jahren verständlich bleiben. Gedacht werden muss demnach in der Zeitlichkeit nuklearer Halbwertszeiten, um sich die Kommunikation zwischen Lebewesen in einer fernen Zukunft vorzustellen.
Vor diesem Hintergrund gilt Katarina Ševićs künstlerische Recherche der Grenzen zwischen Sprache, Bedeutung und speziesübergreifender Kommunikation. Basierend auf ihrer Recherche kombiniert sie visuelle Elemente (Symbole und Schrift) zu einer Partitur, die von unterschiedlichen Singstimmen frei interpretiert wird. Zwar werden die “Noten” von menschlichen Interpret_innen aktiviert, jedoch ist das Ziel, eine eine Klanglandschaft zu schaffen, die nicht nur menschliche Kommunikation berücksichtigt. Tiergeräusche und technische klänge sowie KI-generierte [KI ist kurz für künstliche Intelligenz] Geräusche aus dem digitalen Raum werden einbezogen. Diese Verschmelzung macht das Hörstück der Künstlerin zu einer Übung die Vorstellungskraft zu erweitern und alternative Konzepte zu denken, wenn es um die Weitergabe von Informationen geht. Dabei lässt sie sich u.a. von der Arbeit des Atomsemiotikers Thomas Sebeok inspirieren. Sebeok war ein in Ungarn geborener us-amerikanischer Wissenschaftler, Semiotiker und Linguist, der sowohl menschliche als auch nicht-menschliche Kommunikationssysteme untersuchte. Er schlug u.a. vor, Mythen und Rituale in Form eines “folkloristischen inspirierten Staffel-Systems“ weiterzugeben oder die Gründung einer „Atomaren Priesterschaft“ in Überlegungen zu den Formen des Wissenstransfers einzubeziehen. Auch eigens dafür gezüchtete Arten, die als „lebende Strahlungsdetektoren“ fungieren, wurden spekulativ ins Spiel gebracht. Die Philosophen Françoise Bastide und Paolo Fabbri prägten den Begriff der „Strahlenkatze“ und schlugen vor, dass eine bestimmte Tierart in der Nähe von Strahlungsquellen die Farbe wechseln sollte.
Während die Atomenergie nahezu unbegrenzte Energie für alle verspricht, treibt sie uns unmittelbar an die Grenzen unserer Sicherheitssysteme und Kommunikationsmittel. Während auf der ganzen Welt mit Hochtouren daran gearbeitet wird, eine Endlagerlösung für radioaktive Abfälle zu finden, verfügen wir nicht über die Mittel zukünftig über diese und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, zu kommunizieren. Und es gibt auch noch keine technischen Lösungen, die dauerhaft vor dieser vermeintlichen Gefahr schützen können. Diese Spannungen und die damit einhergehende Komplexität thematisiert Katarina Ševićs in ihrer Arbeit. Dabei bewegt sie sich im Spannungsfeld zwischen Klarheit in der Kommunikation über Atomenergie und den Gefahren die mit ihr einhergehen, die Macht, die von ihr ausgeht sowie die die noch unergründete Frage, was ihre zeitliche Dimension für zukünftiges Leben bedeutet. Die Partitur wird zu einem unheimlichen „Ohrwurm“ in der Ausstellung, der die nuklearen Vergangenheiten und strahlenden Zukünfte von SALZ. TON. GRANIT. thematisiert.

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann KATARINA ŠEVIĆ (Berlin) arbeitet als Künstlerin und wurde in Novi Sad, Jugoslawien/Serbien geboren. Sie studierte an der Fakultät für Intermedia an der Universität der Künste in Budapest.
In ihrer künstlerischen Praxis und für ihre Designprojekte inszeniert sie Texte, Bücher, Artefakte, Orte und Archivdokumente, um dadurch etablierte Kanons und vorherrschende historische Narrative sowie deren Beziehung zu Formen des Handelns und Denkens kritisch hinterfragen und neu rahmen zu können. Sie arbeitet interdisziplinär, wodurch sowohl Objekte und Kostüme als auch Performances entstehen. Sie hat an verschiedenen kollaborativen Projekten teilgenommen, unabhängige Kunsträume in Budapest mitinitiiert und mitbegründet sowie zahlreiche Bücher herausgegeben und veröffentlicht.
https://www.katarinasevic.com/

-
Dominika Trapp

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann Nobody dreams of Nuclear Power Plants
6 Gemälde (je 60 x 80 cm), handgeschöpftes Papier, Aquarellstifte, gepresste Pflanzen, 2024
Dominika Trapps Arbeit taucht tief ein in die intime Beziehung zwischen dem Atomkraftwerk im ungarischen Paks (Paks Nuclear Power Plant (NPP)) und den dortigen Angestellten. Die Künstlerin hat tiefgehende Interviews mit Beschäftigten des Atomkraftwerkes geführt, ihre Interviewpartnerinnen arbeiten dort in unterschiedlichen Positionen, vom Reinigungspersonal und Auszubildenden der lokalen Technischen Schule bis hin zu den Ingenierinnen. Anhand dieser Interviews untersucht Trapp die individuellen Interpretationen der physischen Erfahrungen, die diese Personen mit dem Innenleben des Reaktors haben. Ihre Recherche konzentriert sich darauf, wie subjektiv die Vorstellung von Kernkraftwerken und nukleare Energie ist - sowohl in Bezug auf die Technologie selbst als auch auf den täglichen Umgang mit ihr.
Diese persönlichen Gespräche zeigen das NPP als anthropomorphes technisches Gebilde, dessen Allgegenwärtigkeit, technologische Komplexität und weitreichende soziale und wirtschaftliche Auswirkungen auf die Stadt und das Leben der Menschen im Laufe der Jahre normalisiert wurden und sogar als natürlich angesehen werden. Viele Angestellte haben Schwierigkeiten damit, ihr körperliches Verhältnis zu und ihre Gefühle gegenüber dem Kernkraftwerk zu artikulieren, fast als befänden sie sich im Schatten dieser rätselhaften und oft einschüchternden Technologie. Gleichzeitig vermitteln ihre Beschreibungen des Kernkraftwerks selbst eine lebendige und atmende Kraft. Die Motive, die sie in den Beschreibungen nutzen, sind oft sentimental, fast übersinnlich und sogar familiär. Das NNP wird mit Begriffen wie Zugehörigkeit und Identifikation umrahmt, die Beschreibungen eher der Dynamik einer patriarchal geprägten Familie als denen eines typischen Arbeitsplatzes.
Wie unterschiedlich verschiedene Generationen das Kernkraftwerk wahrnehmen, ist ebenfalls ein zentrales Thema in Dominika Trapps Arbeit und spiegelt wieder, wie sich das Verhältnis zwischen Mensch und Technologie über die Zeit verändert. Ingenieur_innen, die kurz nach der Eröffnung des Kernkraftwerkes xxxx[1] [2] [3] [4] dort angefangen haben, beschreiben es mit nüchterner Präzision und vergleichen das Kernkraftwerk mit einem technischen Körper, der durch eine anatomische Linse seziert wird. Im Gegensatz dazu haben jüngere Angestellte oftmals einen post-digitalen Blick auf das Kraftwerk, der von Science-Fiction und Videospielen wie Minecraft geprägt ist. Diese Gegensätze verdeutlichen, wie unterschiedliche Denkweisen die individuelle Beziehungen zu technischen und industriell geprägten Umfeldern prägen.
In ihren filigranen und intuitiven Gemälden versucht Dominika Trapp, die beschriebenen und äußerst komplexen Assoziationen einzufangen und ein vielseitiges Bild des Kernkraftwerks zu zeichnen. Dafür arbeitet sie auf handgeschöpftem Papier mit gepressten Pflanzen, die sie rund um einen Fischteich in unmittelbarer Nähe zum NPP gesammelt hat. Dieser idyllische Ort dient zudem auch als Hintergrund für Naturfotos, die im Besucher_innen- und Informationszentrum des Kernkraftwerkes ausgestellt und in Form von Kalendern und Postkarten vermarktet werden. Die Bemühungen, nukleare Energie und ihre Infrastrukturen als “grün” darzustellen und ihr ein naturschützendes Potential zuzuschreiben um ihr Image zu verbessern wird in Dominik Trapps Malereien subtil kritisiert indem diese selbst auf dem Papier naturalisiert und quasi einem “Greenwashing” unterzogen werden.
Besonderer Dank: Antal Kovács, Andrásné Kovács, Miklós Takács, Róbert Doroghi, Dr. Katalin Gerákné Krasz, István Bartos, Zoltán Csanádi, Márk Rédl, András Farkas, Erika Schneider, Péter Nagy


Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann DOMINIKA TRAPP (Budapest) schloss 2012 ihr Studium der Malerei an der Ungarischen Universität der Schönen Künste ab. Ihre Praxis zeichnet sich durch ein zweigleisiges Interesse aus: einerseits durch eine sensible malerische Herangehensweise, die Intuition und Introspektion ermöglicht, andererseits durch eine nach außen gerichtete Sensibilität, die Dialoge zwischen Gemeinschaften im Dienste der kollektiven Selbsterkenntnis ermöglicht. In jüngster Zeit hat sie an den Residenzprogrammen von Art in General in New York, der Ersten Stiftung in Wien und FUTURA in Prag teilgenommen. Im Jahr 2020 wurde ihre Einzelausstellung in der Galerie Trafó in Budapest und in den Karlin Studios in Prag gezeigt. Im Jahr 2021 nahm sie an der 14. Baltischen Biennale in Vilnius, 2022 an der Manifesta 14 in Prishtina und 2023 an der EVA International - Ireland's Biennial in Limerick teil. Derzeit ist sie Stipendiatin für Multimedia-Kunst an der Doktorandenschule der Moholy-Nagy-Universität für Kunst und Design.

-
Anna Witt

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann Tanz auf dem Vulkan
zweiteilige Video-Installation, 2024
Anna Witts zweiteilige Videoinstallation nimmt ihren Ausgangspunkt im Wendland, wo die Gemeinde Gorleben zum Symbol der Anti-Atomkraft-Bewegung und zu einem der Kristallisationspunkte der Auseinandersetzung um die Nutzung von Atomenergie in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde. Nachdem 1977 das ehemalige Salzbergwerk bei Gorleben als Standort für ein Nukleares Entsorgungszentrum benannt worden war, entwickelte sich im Wendland eine der bedeutendsten und nachhaltigsten und gesellschaftlich breit aufgestellten Protestbewegungen in Westdeutschland in der Nachkriegsgeschichte. Anna Witt untersucht, wie sich kollektive Formen des Protests über Generationen hinweg in die Körper und Biografien von Aktivist_innen und deren Familien eingeschrieben haben, wofür sie u.a. im Gorleben-Archiv recherchierte.
Der Titel der Arbeit “Tanz auf dem Vulkan” ist eine international geläufige Metapher, die ein riskantes Verhalten trotz drohender Gefahren beschreibt und ihren Ursprung in einer Aussage des französischen Publizisten Narcisse-Achille de Salvandy hat, der den maßlosen, überschwänglichen Konsum des Französischen Königshauses angesichts der aufkeimenden Französischen Revolution kommentiert. Ein Verhalten, das mögliche Parallelen zur mehrheitlichen Haltung gegenüber der drohenden Klimakrise und einer wieder erstarkenden Pro-Atom-Politik ziehen lässt und Gründe aufzeigen, warum sich Menschen aktivistisch engagieren. Im Gorleben-Archiv stieß Anna Witt später auf Material, das zum gleichnahmigen Musikfestival „Tanz auf dem Vulkan am 4. September 1982 gegen den Baubeginn der Zwischenlagerhallen im Gorlebener Wald geplant war. Während dem anschließenden Aktionswochenende wurden von der Polizei zu ersten Mal Hochdruckwasserwerfer eingesetzt um gegen die Protestierenden vorzugehen, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Ein Verfahren gegen das Vorgehen der Polizei ging bis vor das Bundesverfassungsgericht, wurde jedoch nach 10 jährigem Prozess eingestellt, ohne dass es juristische Konsequenzen gab. In den Augenzeuginnenberichten ziehen die Demonstrantinnen Bilanz und formulieren neben der Beschreibung der Eskalation besonders auch Aspekte für kollektive Lernprozesse aus den Erfahrungen des Widerstands. Vermittelt werden soll, wie in einer Gruppe selbstbestimmte, kollektive Handlungsperspektiven entwickelt werden können. Als Protestform bedeutet das, stehen zu bleiben statt zu rennen, mit der eigenen Angst umzugehen, sich in das Gegenüber hinein zu versetzen, sowie konstant zwischen den gesetzten Zielen und dem Wohl der Gruppe abzuwägen. Diese Strategien umschreiben allesamt Fähigkeiten, die den Kern gemeinschaftlichen Handelns widerspiegeln.
In der performancebasierten, großformatigen Videoinstallation erprobt Anna Witt mit Statistinnen im Gorlebener Forst Praktiken der Solidarität angesichts der Konfrontation mit eines auf sie gerichteten Wasserstrahls. Weniger eine Reenactment der Ereignisse von 1982, will Anna Witt mit der perfomativen Versuchsanordnung das gemeinsame handeln der Aktivistinnen aktualisieren. Der Fokus richtet sich dabei auf die Körperlichkeit kollektiven Handelns. Das Wasser wird im Video zu einer abstrakten Gewalt, der die Gruppe durch gemeinschaftliches Handeln begegnet. Anna Witt interessiert, wie man die Fähigkeit zum kollektiven Handeln aktivieren kann und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Im zweiten Teil der Videoarbeit wird diese Ebene in die Zukunft weiter gedacht und es sprechen junge Erwachsene aus dem Wendland über ihr Aufwachsen im Widerstand und wie diese Erfahrungen ihre heutige Haltung im Umgang mit komplexen Herausforderungen und dem Kampf ums Klima geprägt haben.
Das Video ist eingebettet in eine Struktur aus gelben Latten, die den Buchstaben X bilden. Das gelbe X steht als Zeichen für den Widerstand gegen die Atommülltransporte, hinter dem sich die Landbevölkerung, die Kirche und angereiste Atomkraftgener_innen im Wendland vereinten. Ursprünglich wurde das gelbe Kreuz 1988 auf Landstraßen und in Vorgärten als medienwirksame Protestform entlang der Strecke der Castor-Transporte von Wackersdorf nach Gorleben aufgebaut. Heute steht das Zeichen für den Tag X, an dem das 1,5-Grad-Klimaziel unerreichbar wird. Damit vereint das Symbol verschiedene Generationen und Teile der Umweltbewegung
.Besonderer Dank an alle Beteiligte des Projektes, die Freiwillige Feuerwehr Gorleben, Freie Bühne Wendland, BI Lüchow-Danneberg, Meuchefitz, Gorleben Archiv, Kulturverein Raum 2ev, EJZ, HBK Braunschweig

Installationsansicht SALT. CLAY. ROCK © Lucie Marsmann ANNA WITT (Wien/ Berlin) wurde 1981 in Deutschland geboren, arbeitet und lebt in Wien und Berlin. In ihrer künstlerischen Praxis – performativ, partizipatorisch und politisch - schafft sie Situationen, in denen zwischenmenschliche Beziehungen und Machtstrukturen ebenso kritisch ergründet wie Konventionen des Sprechens und Handelns. In ihren Performances bindet sie neben Passant_innen im öffentlichen Raum als auch ganz bestimmte Personen und Personengruppen ein, meist auf unmittelbare und körperliche Weise.
Die Aufgabestellungen für ihre jeweiligen performativen Experimente werden gemeinsam mit den Teilnehmenden entworfen und reichen von wiederholter Nachahmung bestimmter kodierter Gesten bis hin zur Erarbeitung komplexer Choreografien.
In den letzten Jahren wurden ihre Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen in Österreich, Deutschland und international gezeigt, unter anderem im SEMA Seoul Museum of Art, in der Secession Wien, auf der 1. Wien-Biennale im MAK, in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, im Museum Ludwig, Köln, im Austrian Cultural Forum New York, im Kunstmuseum Wolfsburg und im MOCA Museum of Contemporary Art Taipei. Einzelausstellungen hatte sie im Wiener Museum für zeitgenössische Kunst „Belvedere 21“ Contemporary, in der Kunst Halle Sankt Gallen und der Galerie Tanja Wagner, Berlin, im „Marabouparken“ Museum in Stockholm und im Center for Contemporary Art, Prishtina, Kosovo. Außerdem nahm sie an verschiedenen Biennalen teil, so auch der Aichi Triennale 19, 13, der Lux/ICA Biennale of Moving Images, London, der 6. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst und der Manifesta 7 in Norditalien und ist Gewinnerin des Outstanding Artist Award 2020, des Otto Mauer Preises 2018, des Kunstpreises 'Future of Europe' 2015, des BC21 Art Award 2013 und des Kunstpreises der Columbus Art Foundation 2008.






