Marike Schreiber

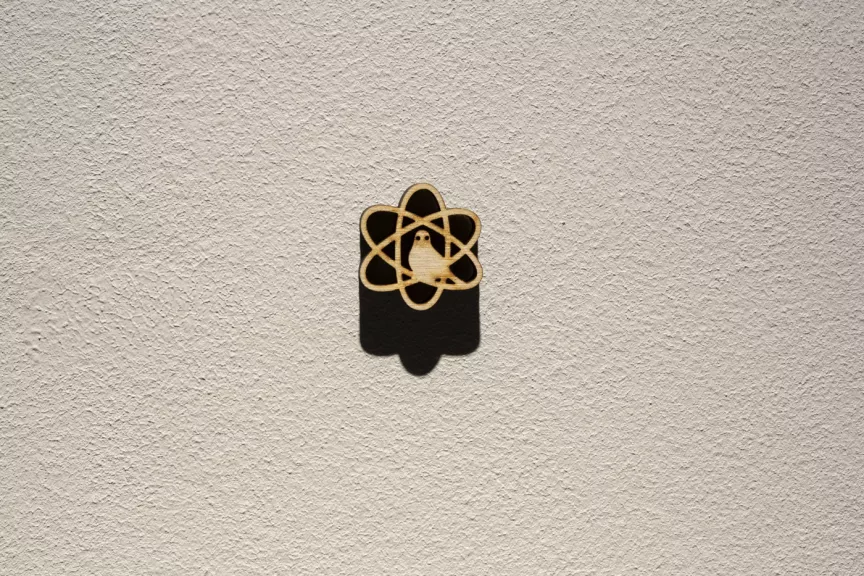
OH STRAHLENDER STECHLIN
Multimedia-Installation mit Bar-Skulptur, Medaille und Schmuckkästchen, Tapete und Audio, 2024
Im September 2024 lud Marike Schreiber zu einer künstlerisch geführten Exkursion - einem artist-led field trip - in das Naturschutzgebiet Stechlin und zum ehemaligen Kernkraftwerk Rheinsberg im Norden Brandenburgs ein. In der vorhergegangenen Recherche interessierte sich die Künstlerin für die Verbindungen des Kernkraftwerkes zum es umgebenden Naturschutzgebiet mit dem Stechlinsee, der lange Zeit eine Schlüsselrolle als „Kühlungsanlage” des Kraftwerkes spielte. Gleichzeitig ist der Klarwassersee noch heute für seine gute Wasserqualität und große Biodiversität bekannt. 1959 entstand hier die Abteilung Experimentelle Limnologie (Wissenschaft von den Binnengewässern) als Außenstelle des Zentralinstituts für Mikrobiologie und Experimentelle Therapie (ZIMET) Jena. Nach der Wende wurde die Forschungsarbeit 1992 weitergeführt. Noch heute befassen sich die Forscher_innen des im Jahr 2000 in die Leibniz-Gesellschaft aufgenommenen Seelabors für Gewässerökologie und Binnenfischerei u.a. mit den Auswirkungen des Kraftwerksbetriebs auf den See und sein Ökosystem.
Im Rahmen von SALZ. TON. GRANIT. ist das Kernkraftwerk Rheinsberg und seine Geschichte grundlegend für die Auseinandersetzung mit dem Erbe nuklearer Infrastrukturen. 1966 als erstes Kernkraftwerk der DDR in Betrieb genommen, wird es seit 1995 als erstes Kernkraftwerk überhaupt gänzlich zur „grünen Wiese” zurückgebaut.
Sowohl der artist-led field trip sowie die in der Ausstellung gezeigte Arbeit befassen sich eingehend mit dieser Geschichte und zeigen die Kontroversen auf, die sich darin abbilden. Ein wichtiger Bezugspunkt für Marike Schreibers Arbeit ist das Werkstor des Kernkraftwerks. Bis heute zeigt es eine Friedenstaube, eines der in der DDR am häufigsten verwendeten politischen Symbole und ein Hinweis auf die politische Betonung der friedlichen Nutzung der Kernenergie mitten im Kalten Krieg. Zur Eröffnung des Kernkraftwerks erhielten alle am Aufbau beteiligten Arbeiter_innen eine von zweitausend extra zu diesem Zweck angefertigten Medaillen. Auf der Vorderseite war die Friedenstaube im Atommodell abgebildet. Auf der Rückseite stand: “In Anerkennung für Ihre Mitarbeit beim Aufbau des 1. Atomkraftwerks der DDR Rheinsberg 9.5.1966”.
Gleichzeitig befasst sich die Arbeit mit den „Umweltsonntagen”, die der Pfarrer Reinhard Dalchow in der evangelischen Kirchengemeinde in Menz als Reaktion auf die Umwelteinflüsse des Kernkraftwerks in den 1980er Jahren mit initiiert hat. Ziel der Reihe war eine offene Diskussion über Umweltschutz und die Folgen der Energiegewinnung in der DDR. Für die erste Veranstaltung wurde das Thema Wasser und Wasserverschmutzung gewählt, über die es zu diesem Zeitpunkt keine öffentliche Diskussion gab. Mit einem „Wasserempfang” in der Kirche - die als Institution ein Schutzmantel für Widerstandsbewegungen in der DDR war - wurde auf die Bedeutung von sauberem Trinkwasser aufmerksam gemacht.
Die beschriebenen Aspekte greift Marike Schreiber, deren künstlerisches Interesse u.a. den Formen wissenschaftlicher Abbildungen und in Bilder übersetzten Daten, Modellen und metaphorischen Begriffen gilt, auf und überführt diese in skulpturale Arbeiten, die im Rahmen des artist-led field trip genutzt und nun im Ausstellungsraum in einer Rauminstallation gezeigt werden. Sowohl die Medaille als auch die Bar für einen Wasserempfang finden sich wieder. Die ikonische Friedenstaube sitzt jedoch nun und spielt so auch auf den Systemwechsel an, der das Ende des 1990 abgeschalteten Kernkraftwerks bedeutete. Die Bar-Skulptur besteht aus mehreren Elementen, die durch drei Stäbe verbunden sind und die Tiefenschichten des Stechlinsees darstellen. Die Anordnung der Gläser auf der Bar und die achteckige Form der Bar selbst beziehen sich auf die Anordnung der 24 Seezylinder des Seelabors im Stechlinsee. Die Behälter mit Seewasser verweisen auf die Diskrepanz zwischen dem über Jahre verunreinigtem und dennoch als sauber geltenden Wasser des Stechlinsees. Bei Führungen in der Ausstellung wird die Bar aktiviert und die Besucher_innen zum Wasserempfang eingeladen.
Zur Finissage der Ausstellung findete ein Umweltsonntag statt, zu dem die Künstlerin gemeinsam mit dem Pfarrer i.R. Reinhard Dalchow und dem Paläontologe Björn Kröger einlud.
Besonderer Dank an AG Rheinsberger Bahnhof, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Reinhard Dalchow (Initiator „Umweltsonntage”), Jörg Möller (Verein Stadtgeschichte Rheinsberg), Grit Ruhland (Soundaufnahme)


MARIKE SCHREIBER (*1982 in Neustrelitz) lebt und arbeitet in der Mecklenburgischen Seenplatte. Sie studierte Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und leitete mit Ari Merten und Yvonne Anders von 2008 bis 2019 den Leipziger Kunstraum Praline, der Ausgangspunkt für beteiligungsorientierte Formate und ortsspezifische Ausstellungen war.
Marikes künstlerisches Interesse gilt der Beschaffenheit von wissenschaftlichen Abbildungen: die Formen und Farben der in Bilder übersetzten Daten, Modelle und metaphorischen Begriffe, welche als Chiffren eines bestimmten Blickes auf die Welt – von Vorstellungen des Mensch- und/oder Natur-Seins verstanden werden können. Diese zweidimensionalen Abbildungen verwendet sie als Material für modellhafte Skulpturen und Installationen.




